Es war das Jahr 2015. Prof. Dr. Vera Regitz-Zagrosek ist an der Académie Francaise zu einem Vortrag über Gendermedizin eingeladen – der ersten Veranstaltung zu diesem Thema in 300 Jahren. Die Internistin und Kardiologin ist Direktorin des Instituts für Geschlechterforschung in der Medizin (GiM) der Charité. Dass Männer und Frauen biologisch unterschiedlich sind, ist quasi eine Alltagsbeobachtung. Aber in der Medizin und der Forschung scheint es, als ob dieser Fakt lange unberücksichtigt blieb und die Annahme eher lautete: Krankheiten verlaufen geschlechtsneutral. Studien der vergangenen Jahre aber zeigen, dass dieser Ansatz nicht zielführend ist. Die Gendermedizin will das ändern.
Gender-Medizin: Auch für Männer
Beim Wort Gendermedizin taucht oft als erstes der Gedanke auf: Da geht’s nur um Frauen. Das stimmt so nicht. Vera Regitz-Zagrosek erklärt in einem Interview mit der ARD, „dass die Erforschung der Unterschiede zwischen Männern und Frauen in der Medizin kein Unsinn ist, sondern etwas höchst Notwendiges“. Warum? Nicht nur beim Herzinfarkt, sondern auch bei zahlreichen anderen Erkrankungen zeigen die Geschlechter unterschiedliche Symptome und reagieren anders auf pharmakologische und invasive Therapien.
Warum Männer und Frauen Diagnose zu unterschiedlichen Zeitpunkten erhalten
Autoren einer dänischen Studie schreiben zum Beispiel: „Männer und Frauen sind unterschiedlich von Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Osteoporose und Autoimmunerkrankungen betroffen. Darüber hinaus deuten viele frühere Studien auch auf eine Befangenheit in Diagnose und Behandlung hin, zum Beispiel, dass Osteoporose bei Männern unterdiagnostiziert wird, während eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung bei Frauen unterdiagnostiziert wird.“ Für ihre Studie werteten die Wissenschaftler Daten von über 6,9 Millionen Krankenhauspatienten aus über 21 Jahren aus. Das Ergebnis: Frauen erhielten eine Diagnose in der Regel vier Jahre später als Männer. Wobei Osteoporose beispielsweise eine Ausnahme bildet. Denn: „Wenn Männer Krankheiten bekommen, die im Gesundheitssystem als Frauenkrankheiten angesehen werden, bekommen sie die Diagnose meist später und in einem ernsteren Stadium“, zitiert Spiegel-Online Marcia Stefanick von der Standford University. Sie war nicht an der dänischen Analyse beteiligt. Für sie gelte übrigens auch der umgekehrte Fall, sprich wenn Frauen an einer Krankheit leiden, die eher Männern zugeschrieben wird.
Beispiele

Auch Vera Regitz-Zagrosek weiß, dass Frauen und Männer oft unterschiedliche Risikofaktoren für Krankheitsentstehung, Krankheitsverlauf und Behandlungsrisiken aufweisen. Sie schildert ein Beispiel von einer Frau, die einen Herzinfarkt erlitten hatte und ihre Periode hatte. Die Ärzte fragten sich, ob sie der Patientin ein Thrombolytikum, also ein stark gerinnungsaktives Medikament, das Blutgerinnsel auflösen kann, geben dürfen. Oder ob die Betroffene dann verbluten würde. Bei der Forschung und Entwicklung dieses Medikaments hatte, so die Instituts-Direktorin, niemand daran gedacht, so eine Fragestellung zu prüfen. Für sie geht es deshalb in der Gendermedizin darum, spezifische Ansätze zu finden, um Männer und Frauen besser und effizienter behandeln zu können. Dabei wird nicht nur nach biologischen, sondern auch auf psychosoziale Unterschiede geschaut, aber genauso auf Umwelteinflüsse. Der Grund: Die Forscher wollen verstehen, welchen Einfluss die Faktoren auf Krankheiten, Verläufe, Therapien und Gesundheit haben können.
Chromosomen machen einen Unterschied

Denn schon allein, dass Männer ein X- und ein Y-Chromosom haben und Frauen dagegen zwei X-Chromosomen schafft unterschiedliche Voraussetzungen. Die X-Chromosomen sind überwiegend mit Herz-, Hirn- und Immunfunktion beschäftigt, wie die Forscherin erklärt, die Y-Chromosomen dagegen mit Sexual-Aufgaben. Nun sei es so, dass ein weibliches Chromosom aus etwa 1500 Genen besteht, ein männliches aus ca. 100. Die Natur habe es nun aber so vorgesehen, dass das zweite X-Chromosom freiwillig stillgelegt werden soll, um einen Ausgleich zu schaffen. Aber: Etwa 15 bis 20 Prozent der Gene auf dem zweiten X-Chromosom entgehen der sogenannten X-Inaktivierung. „Und die bilden einen wichtigen Reservepool für die Frauen“, wie Vera Regitz-Zagrosek in der Sendung alpha beim Bayrischen Rundfunk ausführt.
Auch die Sexualhormone machen einen Unterschied. Östrogen stehe eher für regenerative Prozesse und Fürsorge, während Testosteron Wachstum und Aggressivität fördere. Aufgrund unserer Sexualhormone reagieren wir auch anders auf Umwelteinflüsse, ist die Wissenschaftlerin überzeugt. Unter dem Einfluss der Hormone würden unsere Gene zum Beispiel Stress, Rauchen Feinstaub & Co. anders verpacken, so Vera Regitz-Zagrosek.
Die Erkenntnisse zu den genetischen und hormonellen Unterschieden ordnet Medizin-Journalistin Daniela Remus in einem ARD-Interview so ein: „Das ist relativ neues Wissen. Die Forschung dazu erstreckt sich auf die vergangenen fünf Jahre. Man hat festgestellt – und das war ganz lange unbekannt, dass die Immunsysteme der Männer und der Frauen unterschiedlich reagieren. Das liegt daran, dass auf den Immunzellen Rezeptoren sitzen, die Geschlechtshormone binden können. Man hat festgestellt, wenn viel Östrogen gebunden wird, reagiert das Immunsystem sehr viel stärker. Das Testosteron, das männliche Geschlechtshormon, dämpft das Immunsystem eher und fährt alles ein bisschen runter.“ Das erkläre zum Beispiel, warum Männer und Frauen unterschiedlich anfällig für Krankheiten sind.
Warum war der geschlechterspezifische Ansatz bisher untergeordnet?
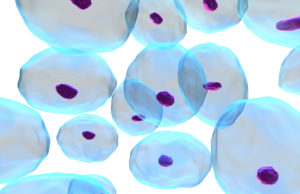
Warum die unterschiedlichen Geschlechter so lange keine Rolle in der Medizin gespielt haben? Die Spiegel-Online-Redaktion antwortet darauf so: „Medizin ist männlich, schon seit Jahrhunderten. Anatomische Forschung, die Dosierung von Medikamenten oder krankheitstypische Symptome: Maßstab ist der männliche Körper. Für Frauen kann das tödliche Folgen haben.“ Medizin-Journalistin Daniela Remus sagt dazu: „Aber die Forschung macht sich auf den Weg. Es gibt zum Beispiel Vereinbarungen, dass man sagt: Wenn Arzneimittel getestet werden, dann muss auf jeden Fall festgehalten werden, ob man männliche oder weibliche Teilnehmer testet und was das für Konsequenzen hat, weil das nicht immer in einen Topf zu werfen ist.“

